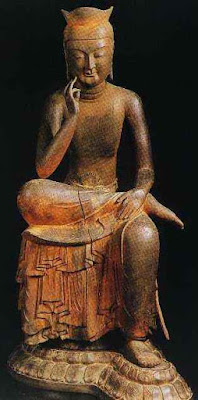Ich erinnere mich daran, als hätte ich ihn gekannt. Anmerkungen zu Laszlo Böszörmenyis "Georg Kühlewind, Ein Diener des Logos"
Und ja, natürlich erinnere ich mich, und natürlich habe ich Kühlewind ein wenig gekannt. Ich hatte ihn, vor rund 35 Jahren, vom Düsseldorfer Flughafen abgeholt- was ihm die lange Weiterfahrt mit dem Zug in ein Studienhaus im Sauerland ersparte, wo er, zusammen mit einer Pianistin, ein einwöchiges Seminar zu Bewusstseinsfragen gab. Einer der Schwerpunkte war die meditative oder intuitive Erfassung von modernen Kompositionen, vorzugsweise Gershwin. Dass es ein Seminar der vertieften und schmerzhaften Selbsterfahrung werden sollte, war mir am Flughafen noch nicht klar. Sehr wohl aber, dass Kühlewinds Maschine erhebliche Verspätung haben würde. Ich stand vor den automatisch öffnenden Glastüren im Wartebereich, während der Ticker die sich nähernden und gelandeten Maschinen anzeigte, und es gab keinen Zweifel: Es würde nicht nur zeitlich eng werden, es würde nicht annähernd rechtzeitig zu schaffen sein.
Während mir ein nicht zu verkennender Kühlewind mit dieser Ich-bin-ein-Professor-aus-Budapest-Brille, dem schmalen, klugen Gesicht eines Schachspielers, einer Gelassenheit bis in jede einzelne Bewegung hinein, den wachen Augen und einem Hauch von wacher Distanz durch die trüben, aufgleitenden Glastüren entgegen kam, war mir bewusst, dass annähernd 80 Gäste seines Kurses in absehbarer Zeit entschlossen zum ausgezeichneten Abendessen mit Rohkost und Schnittchen schreiten würden.
Natürlich erkannte ich den Mann anhand der Fotografien in vielen seiner Bücher und Artikel. Er war so etwas wie ein umstrittener Star, einer, der vielleicht die Chance darstellte, die verkrustete, in ihrem Kern reaktionäre öffentliche Anthroposophie zu reformieren, obwohl diese seit den 80ern wuchs wie nie, gründete, expandierte und große Teile der Alternativen anzog. Aber Kühlewind, der auf Engagement und persönlicher ethischer und geistiger Schulung auf hohem, selbstkritischem Niveau bestand, war vielen einfach viel zu "schwierig". Nicht nur in intellektueller Hinsicht; Kühlewind hatte keine Hemmungen, den Leuten ins Gesicht zu sagen, was er dachte, auch öffentlich: "Selbst wenn ein Engel sich wunderbarer Weise vor Ihren Augen auf der Hauptstraße vor Ihren aller Augen materialisieren sollte, womit wollten Sie ihn denn erkennen?" donnerte er die verdutzten Esoteriker an.
Er stieg in meinen Wagen ein, das Köfferchen auf dem Rücksitz, die Brille zurecht gerückt, ein charmanter Blick, und schon ging es durch die Stadt auf die Autobahn. Wir kannten uns nicht, wie war der Flug, was machen Sie so. Mir fiel seine Sitzhaltung auf, die irgendwie leicht, beiläufig, entspannt wirkte. Dagegen fuhr ich selbst am Limit des Erlaubten und Angemessenen, immer mehr und mehr besessen davon, was die 80 Gäste, die uns erwarteten, jetzt wohl gerade taten. Ich kreiste um das Thema, mit einer Anmaßung von Verantwortung, die mir gar nicht zustand; ich war doch nur der Fahrer. Aber ich konnte nicht aufhören, mich verantwortlich zu fühlen, ich wollte es gut machen, ich wollte es recht machen. Der Meister aus Budapest war so still, er war eingenickt. Währenddessen ging es hinter Olpe auf die Bergstraßen, durch die Dörfer, schon fast dämmrig, ich war praktisch in Rage, müsste scharf vor einem Vogel auf der Straße bremsen. Der Meister wachte durch den Ruck auf und erklärte, fast begütigend: Die Vögel weichen immer rechtzeitig aus.
Schade eigentlich, während der Wald um uns dichter und dunkler wurde, schade, dass ich einfach nicht herunter kam, während der Meister weiterhin vollständig entspannt und offen neben mir saß, auch am letzten Abzweig zur Anhöhe vom Studienhaus. Dann setzte ich ihn ab, vielen Dank, machen Sie sich keine Mühe, ich parkte ein. Er verschwand mit seinem Koffer in seinem Zimmer, es war sonst kein Mensch zu sehen, das Abendessen war längst beendet, und in der Küche klapperte es. Alle meine schlimmen Erwartungen waren eingetroffen. Durchgeschwitzt öffnete ich die schwere Tür zum großen Saal, worauf das Stimmengewirr kurz jäh verstummte; dann sahen alle: da war nur ich. Ich setzte mich am Rand auf einen freien Stuhl, und das Gemurmel setzte wieder ein, durchsetzt von ungeduldigen Ausrufen wie "Unverschämtheit", aber es passierte lange Zeit nichts weiter. Offenbar speiste der Meister in seinem Zimmer. Vielleicht öffnete er das Fenster und genoss die kalte Luft, das Murmeln des Bachs, das Wogen der hohen Fichten. Vielleicht sammelte er sich, meditierte oder streifte die Emotions- Aura seines Fahrers ab, wer weiß. Die Stimmung im Saal war inzwischen vor- revolutionär und steckte mich inzwischen selbst ein wenig an. Warum, zum Teufel, hatte ich mich so beeilt? Würde ich Zeuge einer Rebellion, eines Tribunals werden?
Nein, die Tür öffnete sich, der Meister schritt ans Podium, grüßte, eröffnete das einwöchiges Seminar, erläuterte die Strukturen, forderte Aktivität und Konzentration der Teilnehmer ein, kündigte Formalitäten an und machte ein oder zwei Scherze. Danach begann der anspruchsvolle Abendvortrag mit anschließendem Konzert. Was auch immer an Emotion den Saal vorher beherrscht haben sollte, hatte Kühlewind innerhalb weniger Minuten restlos abgeräumt und frei gemacht. Seine pure Präsenz löste all das, was auch mich vorher getrübt und umgetrieben hatte, in sich auf. Das Moment war gesetzt, die Arbeit begann, die Woche gehörte ihm.
Für mich war sicherlich vieles eindrücklich an den Begegnungen mit Kühlewind, aber am meisten zu schaffen machte mir dieses Grundproblem, das sich an seiner Entspanntheit aufschaukelte: Das genügen wollen, es recht machen wollen, das anerkannt sein wollen, das rechtzeitig da sein wollen- all das Wollen, dem nie ausreichend Bestätigung entsprang, das nie genug war, und das - wie in dieser Begegnung mit Kühlewind- verhinderte, tatsächlich real präsent zu sein.
In Böszörmenyis vorliegendem Buch "Ein Diener des Logos" (1) finden sich in Erinnerungen, Anmerkungen und Text-Schnipseln einige ähnliche Erfahrungen Anderer, die nicht selten wirkten wie Begegnungen mit einem Zen- Meister, in einer manchmal schockierenden Direktheit: "Ein guter Freund von mir hat einmal Georg davon erzählt, wie sehr es ihn quält, dass er in seiner Vergangenheit so vieles falsch gemacht hat. Georg hat ihn angeschaut und lapidar gesagt: "Was kümmert dich das?"" (2) Der Werdegang, das persönliche Erzähl- Muster, die biografische Erklärung, das zählte eben nur insoweit, wie es die Ich- Präsenz in der Situation beeinträchtigte oder nicht. Der Blick zurück war dem gegenüber nur das Muster eines selbst- referentiellen Ego. Wie merkwürdig es wirken kann, dass dies ("Mit anderen Worten: Anstatt sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, versucht man die Gegenwart zu erleben" (3)) als "Stärkung der kreativen Kräfte des Überbewusstseins" (3) nicht nur Teil des geistigen Schulungsweges, sondern auch einer spirituellen Therapie Kühlewinds war, aber auch selbstverständliches Credo jeder materialistischen Verhaltenstherapie nach Rogers ist, entgeht Böszörmenyi. Nostalgie war eben ebenso wenig Kühlewinds Ding wie sentimentale Selbstverstrickung. Denn dort, genau dort "wohnen die mehr oder weniger tierischen Gestalten unserer Bewusstseinshölle. Die saugen unsere geistigen Kräfte ab." (3)
Dabei hatte der Meister selbst eigentlich gute Gründe für eigene Verstrickungen. Er wurde 1924 als Gyorgy Szekely in Budapest geboren- Kühlewind war das von ihm gewählte Pseudonym für den westlichen Verlag in Ostblock- Zeiten- der "Name ist Programm" oder ähnlich drückte er es einmal aus. Von seiner jüdischen Herkunft erfuhr er erst beim Schuleintritt, wegen des Religions- Unterrichts. Wie man Georg Kühlewinds Tagebuch (im Anhang des vorliegenden Buch) aus der Zeit entnehmen kann, wurde es nach der Besetzung Ungarns im März 1944 so ernst, dass der Junge an seinen möglichen Tod dachte: "Merkwürdiges, irreales Gefühl. Wie ein Traum. Und eine Art Doppelheit: Das eine bin ich, meine Gedanken, das andere das durch die Deutschen besetzte Budapest." (4) Er ahnt die nahende Katastrophe. Der Traum von einer organisierten Widerstands- Bewegung erfüllt sich nicht. In der Gefahr bewegen ihn existentielle Grenzerfahrungen, bis ihn im Mai 1944 tatsächlich die Einberufung zur Zwangsarbeit trifft- und damit der Entschluss: "Ich werde alle Kraft dareingeben, mein Schicksal anständig und vorbildlich zu ertragen." (5) Nach einer kurzen Flucht wurde er aufgegriffen und ins KZ Buchenwald deportiert. Er überlebte zusammen mit seinem Vater. In der aufgewühlten und zunächst desorientierten Phase nach dem Krieg begegnete Kühlewind verschiedentlich Werken von oder über Rudolf Steiner, die aber zunächst keinen bedeutenden Eindruck auf ihn machten. Das änderte sich erst 1958, mit dem Studium der Philosophie der Freiheit, womit ein regelrechtes inneres Studium begann.
Man muss Laszlo Böszörmenyi natürlich zugute halten, dass er diese Mischung aus Tagebuch- Notizen, Fragmenten aus Interviews, persönlichen Begegnungen und Gesprächen, Texten und Reflexionen zusammen trägt und für den Leser erschließt. Der fragmentarische Charakter, ständige Zeitsprünge und eingestreute Erinnerungen und Überlegungen lassen aber keine Biografie im engeren Sinne entstehen, sondern ein Mosaik, das dann leider teilweise auch noch mit persönlichen Betrachtungen zur Weltlage, Pandemie und 9/11 überlagert wird. Die biografischen Fragmente laufen auf das zu, auf das es Böszörmenyi letztlich ankommt, und das ist eine umfassende Werkgeschichte der Schriften Kühlewinds. Vielleicht ist das auch durchaus in dessen Sinne, da der Lehrer, der sich in seinem Werk mit der "Sphäre des lebendigen Denkens" (6) beschäftigt hat, nie viel Aufhebens um seine Person gemacht hat.
Böszörmenyi nimmt erst mit der Werkgeschichte, in der er jedes einzelne Buch Kühlewinds inhaltlich und chronologisch betrachtet, richtig Fahrt auf- das Fragmentarische und Sprunghafte hört weitgehend auf, wird aber ersetzt durch eine Fülle von Fußnoten auch in Form von Anekdoten, die durchaus erhellend sind. Es wird dadurch eine Art paralleler Kommentierung geschaffen. Die systematische Darstellung der Schritte der Entwicklung in Kühlewinds Arbeiten wird diese sicherlich - gelten sie doch in anthroposophischen Kreisen oft als so "schwierig" - zugänglicher machen. Schon die inhaltlichen Übersichten mögen es Manchem erleichtern, sich zu entscheiden, hier oder dort einzusteigen- oder manche Titel zu meiden. Es gibt Bücher, die Kühlewind gerade im Blick auf die breite Öffentlichkeit geschrieben hat- und andere, die sich speziell an geistig Übende richten oder an Interessierte an Themen des Neuen Testaments. Man findet sogar spezielle weihnachtliche Titel oder solche, die sich mit Buddhismus oder dem Grals- Thema beschäftigen. Alle, muss man sagen, in der typischen Nomenklatur, Stilistik, Kühle und Sachlichkeit, die Kühlewind ausmacht. Am Ende gibt es von ihm auch linguistische Spezialwerke.
Nun, "schwierig" sind sie alle, weil der Meister nun einmal ungewohnte Perspektiven einnahm. Man kann die Bücher nicht wirklich "quer" lesen, da sie ein konzentriertes Einstimmen voraus setzen. Wer Kühlewind nur "passiv" lesen, also Informations- Bits entnehmen will, bleibt mit einiger Sicherheit sehr bald hängen und stecken. Kühlewind entzieht sich dem leichten Konsum- seine Texte sind selbst "Übungen", die konzentriertes, teilweise hoch verdichtetes Denken erfordern. An vielen Stellen kommen sie meditativen Texten gleich, beinhalten auch praktisch und faktisch manchmal diverse meditative Übungen. Die Führung durch die Fülle dieser diversen Texte übernimmt Böszörmenyi zuverlässig und sachlich.
Das Zugänglich - Machen für den interessierten Leser schränkt er teilweise aber auch wieder durch typisch anthroposophischen Wortgebrauch oder durch teilweise esoterisches Pathos ein- den Bruch des Bewusstseins mit dem alltäglichen Denken setzt er der "Intensität eines Vulkanausbruchs" (6) gleich, eine "vertikale Wolken- und Feuersäule, die Mose und sein Volk in der Wüste leitete" (6). Damit charakterisiert werden soll die erlebte Aktivität des meditativen Bewusstseins im Vergleich zum konstatierenden, reflektierenden Alltagsbewusstsein. Um mögliche Wege zu einer solchen möglichen Ich- Erfahrung als reines Bewusstsein aufzuzeigen, schiebt Böszörmenyi eine Reihe einfacher Konzentrations- und Denkübungen ein, die er jeweils für den Interessierten mit vielen Verweisen auf Texte Kühlewinds verbindet. Böszörmenyi nähert sich den Büchern Kühlewinds also von mehreren Seiten an. Seine Biografie wird damit mehr und mehr selbst zum Schulungs- Text, zum Medium für Interessierte an geistiger Übung und Erfrischung. Für meinen Geschmack nimmt die Begeisterung des Autors immer mal wieder überhand, wenn das anthroposophische Pathos mit ihm durch geht: "Es lieferte aber in ihm das Feuer der Sehnsucht nach dem Licht des Logos, und er hat sich entschlossen, den Weg der Umkehr radikal, ohne Kompromisse anzugehen und ein Diener des Logos zu werden." (7) Autsch.
Was der Autor letztlich ausdrücken möchte, ist, dass der Bewusstseins- Lehrer Kühlewind mehr als ein halbes Jahrhundert nach Steiner näher dran ist an den realen Problemen derer, die sich näher mit einem modernen Schulungsweg beschäftigen möchten: "Sein besonderer Verdienst ist, dass er auf die Hindernisse in den Anfängen ausführlich eingeht" (8) - Steiner selbst sei "dank seiner einmaligen spirituellen Begabung" (8) einfach zu weit weg gewesen von Alltagsmenschen wie du und ich. Er hat, mit anderen Worten, zu viel voraus gesetzt. Selbst wenn von "gesundem Menschenverstand" bei Steiner die Rede war, meinte er eine Qualität von Konzentration, die schon dem Menschen des 20. Jahrhunderts verloren gegangen sein muss. Die Verödung und das kollektive Aufmerksamkeits- Defizit nehmen seitdem stetig weiter zu. In diese Bresche ist Kühlewind gesprungen.
Kritisch anzumerken ist vielleicht noch, dass der Autor auch in der Folge selbst nicht immer konzentriert seinem Anliegen folgt. Ohne Not verzettelt er sich in Statements zu dem leidigen Thema, ob Anthroposophie als wissenschaftliche Disziplin anzuerkennen sei (9). Auf Seite 180 werden plötzlich wieder Überlegungen zur Pandemie eingestreut.
Dann aber, nach all diesen Exkursen, Erklärungen, Erläuterungen und Werk- Darstellungen kommt der Autor wieder zur eigentlichen biografischen Betrachtung zurück. Es geht auch um Freundschaften, deren plötzliches Ende und um den zwiespältigen Massimo Scaligero, der in der Form und Vielfalt seiner Werke mehr als Vorbild für Kühlewind gewesen sein muss. Selbst die Form des hoch verdichteten, imaginativen, aber zugleichstrukturierten Schreibens und Denkens der beiden Autoren und Lehrer hat viele Gemeinsamkeiten. Kühlewind muss Scaligero öfter in Rom getroffen haben, bis zu einem Bruch, der leider nicht erläutert wird. Der offenbar überaus gesellige Scaligero war, was Böszörmenyi nicht ausführt, ein faschistischer Denker mit großer Nähe zu Mussolini selbst. Eine denkbar schwierige Konstellation.
Im letzten Teil -vor den Dokumenten im Anhang- geht es um Gruppen, die nach Kühlewinds Tod in seinem Namen arbeiteten, um Meditations- Kreise überhaupt, aber auch um die Beziehung des Meisters zum Zen- Buddhismus und zu den "Sternenkindern"- Kindern mit besonderen Begabungen. Da Böszörmenyi auch an dieser Stelle wieder zu einem Exkurs -über die Autorin Gitta Mallasz und deren Themen- ausholt, darf man annehmen, dass das vorliegende Buch insgesamt eine Zusammenfassung diverser vorliegender Texte und Überlegungen darstellt. Vieles trägt sich und erhellt sich gegenseitig, manches wirkt weniger ausgereift, aphoristisch oder nur durch Fußnoten eingebunden. Immer wieder kann der Eindruck entstehen, dass hier eine reichhaltige Material- Sammlung zu einer großen Biografie vorliegt, die nicht ganz abgerundet erscheint. Um so mehr mögen diese etwas fragmentarisch wirkenden Elemente mit dem Schwerpunkt eines vertieften Einblick in das Gesamtwerk einen guten Zugang bieten für eine Generation von Anthroposophen, Logos- Jüngern und weitläufiger Interessierten, die eben als Nachgeborene mit einer ganz neuen Fragehaltung an den Lehrer Kühlewind heran kommen. Denn im vorliegenden Buch werden ebenso sachdienliche, faktische Hinweise zu den meditativen Texten Kühlewinds thematisiert wie der Zugang zu seiner menschlichen Art, seinen Beziehungen und Entwicklungen geebnet. Vielleicht erleichtert die etwas sprunghaft und fragmentarisch wirkende Darstellung einen Zugang, den eine glatte, runde, zeitlich straff getaktete Biografie auch hätte verstellen können.
Probieren Sie es einfach aus.
Anmerkungen, Verweise
1 LaszloBöszörmenyi, Georg Kühlewind. Ein Diener des Logos, Stuttgart 2022
2 Laszlo Böszörmenyi, S. 197, Anmerkung 160
3 LB S. 196f
4 LB S. 46
5 LB, S. 56
6 LB, S. 74
7 LB, S. 83
8 LB, S. 84
9 LB, S. 108