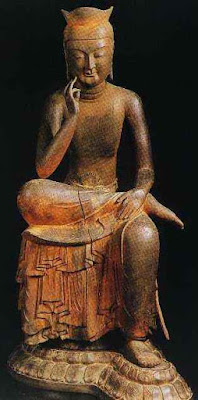Raumschiff Anthroposophie: Bordmechaniker Ansgar Martins analysiert den Zustand. Zur Demokratisierung der Rezeption Rudolf Steiners
Hallo, hallo, Erde an Jupiter, wir melden Probleme bei der Landung. Raumschiff Anthroposophie hat hundert Jahre nach dem Ableben des Begründers unvorhergesehene Aussetzer nicht nur bei der Landung, sondern auch beim Start, und selbst die Rostschutzfarbe des Raumschiffs blättert ab. Wir lassen von unserem Bordmechaniker Ansgar Martins analysieren, woran es liegt. Das fette rostige Ding hebt einfach nicht ab! Immerhin haben wir bereits eine Analyse der Anthroposophie nach Rudolf Steiners Tod in Buchform vorliegen (1), woran wir uns mangels einer Gebrauchsanweisung des Raumschiffs bestens orientieren können.
Was ergibt nun die Analyse des Bordmechanikers?
Er stellt eine vielschichtige, keinesfalls einseitige Evolution der Anthroposophie seit 1925 fest- ansonsten hätte die anthroposophische Bewegung wohl auch kaum 100 Jahre nach dem Tod des Begründers überlebt. Ansgar Martins legt dar, dass die deutschsprachige Anthroposophie nach dem Ableben Rudolf Steiners im Jahr 1925 keineswegs eine monolithische Einheit darstellte, sondern eine dynamische Landschaft ideologischer Transformationen und Ausdifferenzierungen, die sich in verschiedenen, oft simultan existierenden Auslegungsformen manifestierten und nicht auf eine lineare "Generationenfolge" reduziert werden können. Das bedeutet aber auch, dass die unterschiedlichsten Berufe, Passionen und Spleens im Rahmen des anthroposophischen Kontextes ausgelebt werden können- sagen wir, von homöopathischer Tierbehandlung über Fortbildungen zu Management- Aufgaben in eigenen Konzernen bis hin zur Augen- Eurythmie für Menschen, die gern mit ihren Augen tanzen, statt eine Brille zu benutzen. Anthroposophie kann eine Blaupause für alle möglichen Interessen- Gruppen sein- das macht sie interessant und vielfältig und, vor allem, adaptionsfähig.
Die ursprüngliche apokalyptische Prägung und endzeitliche Mission, die man in der Gründergeneration feststellen kann, hat eine gewisse Anziehungskraft- selbst heute noch, nachdem das magische Jahr 1998 längst vorbei gezogen ist. Die frühen Anthroposophen waren tief in ein apokalyptisches Narrativ eingebunden, das sie selbst als Protagonisten einer kosmischen Heilsgeschichte sah. Sie erwarteten ihre eigene Wiederkunft- die der vorhandenen, von Steiner so beschriebenen platonischen und aristotelischen Zweige um die Jahrhundertwende zum 21. Jahrhundert, um den Dämon Ahriman zu bezwingen und die Menschheit vor einem prognostizierten spirituellen Niedergang zu bewahren. Wie bei anderen Kulten gab es also eine Prophezeiung und ein Armageddon, das vor über hundert Jahren mit den dämonischen Jahreszahlen 666 assoziiert war- 1998 war danach das dreifach addierte Zeichen des Sonnendämons. Das haben Sie nicht verstanden? Das macht nichts. Rudolf Steiner hat seine spirituellen Elitetruppen am Ende des Jahrtausend prophetisch in die Inkarnation gerufen, um der bevorstehenden Inkarnation des Ahriman etwas entgegen setzen zu können. Leider hat diese so genannte KULMINATION nur so mäßigen Erfolg gehabt. Den größten Aufwind, gesellschaftliche Anerkennung und institutionelle Erfolge feierte die Bewegung eher in den 80ern. Niemand weiß auch so genau, wo zum Teufel der Antichrist eigentlich steckt.
Ach ja, und manchmal sind Anthroposophen - vor allem orgenisierte- auch so gewöhnlich. Diese Post-mortem-Konflikte und die Erosion der ursprünglichen Autorität zum Beispiel. Zwei Fraktionen, zwei Frauen, die nach Rudolf Steiners Tod um die Macht kämpften: Die Ära nach Steiners Tod war von erbitterten Auseinandersetzungen innerhalb des sogenannten "Urvorstands" der Anthroposophischen Gesellschaft gezeichnet. Diese Konflikte, insbesondere zwischen Marie Steiner-von Sivers und Ita Wegman, spiegelten tiefgreifende Differenzen in der Auslegung des geistigen Erbes Steiners wider und schwächten die Geschlossenheit der Bewegung nachhaltig. Marie Steiner- von Sivers kämpfte mit harten Bandagen um ihre Privilegien als Ehefrau und Managerin des Meisters, was dann zu gegenseitigen Ausschlüssen, Kampagnen, Rufmord- Kampagnen und juristischen Auseinandersetzungen führte. Keine Partei schenkte der anderen etwas. Gemeinsam kämpfte man dann auch gegen Einsteiger, Aufsteiger und Aussteiger. Nehmen wir den visionären Katholiken Tomberg, der mit frömmelndem Unterton die Wiederkunft Christi in diversen Wetterphänomenen witterte und verkündete: Den Tomberg, der ich noch bitter arm war, hat man gemeinsam kalt gestellt, isoliert, öffentlich verdammt, und damit in die Arme der katholischen Kirche zurück getrieben.
Ein anderes, etwas aus der Mode gekommene Stilmerkmal früher Anthroposophen war die Reinkarnations- Biographik als existenzielle Selbstverortung. Was bedeutet das? Die Lehre von der Reinkarnation, insbesondere die von Steiner vermittelten "Karmavorträge", diente der frühen Anthroposophie als fundamentales Instrument zur existenziellen Selbstverortung. Mitglieder, insbesondere im inneren Kreis, deuteten ihre individuellen Lebenswege als Teil einer umfassenderen kosmischen Historie, oft mit Bezügen zu vergangenen Inkarnationen berühmter Persönlichkeiten, was ihren vermeintlichen Auftrag in der Gegenwart legitimierte. Man war immer etwas Berühmtes, was auch schon Rudolf Steiner zu Lebzeiten zu gewissen humorigen Bemerkungen bewegte. Aber im Kampf um Macht und Bedeutungshoheit wurde die Reinkarnationsreihe gerne auch als Mittel der esoterischen Denunziation benutzt. Statt direkt zu attackieren, behauptete man einfach, Rudolf Steiner habe in internen Gesprächen offenbart, Albert Steffen sei die Reinkarnation des Kaisers Hadrian, der dann eine weniger sympathische und gänzlich unspirituelle Persönlichkeit gewesen sein soll. Reinkarnation- Biographik kann eben auch eine Kampfmethode sein. In Anthroposophistan kann man damit Existenzen vernichten.
Ansgar Martins meint, dass ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine signifikante Verschiebung des Fokus innerhalb der Anthroposophie zu bemerken sei. Ursprünglich esoterische und apokalyptische Elemente traten in den Hintergrund, zugunsten eines verstärkten sozialreformerischen Engagements. Steiner wurde nun als Vordenker und Wegbereiter ökosozialer Bewegungen interpretiert, und Konzepte wie die "Dreigliederung des sozialen Organismus" fanden Eingang in aktuelle gesellschaftliche Diskurse um Ökologie und direkte Demokratie. Anthroposophie fand eine neue sozial-ökologische Reinterpretation und Reinkarnation: Am Vorabend der Gründung der grünen Partei gingen Sozialreformer und Natur- Bewahrer plötzlich Hand in Hand mit den gesellschaftlich aktiven Anthroposophen, die zudem noch populär waren und Seminare, Tagungen, öffentliche Vorträge anboten, und zwar mit großem Erfolg. Anthroposophie war vordergründig nichts mehr für skurrile Eskapisten, sondern für gesellschaftliche Reformer, die Banken, Landwirtschaft, Studium, Psychiatrie, Krankenhäuser neu denken und gestalten wollten. Im Hintergrund warteten allerdings die ewigen Zweigleiter, dass der Sturm vorbei zog, und ja, tatsächlich, irgendwann war man dann auch wieder unter sich.
Martins macht in diesen Verwandlungen des Esoterik- Unternehmens Anthroposophie eine weitere Häutung aus: Die "Wiederentdeckung" des jungen Steiner und die Transformation seiner Ich-Philosophie: Seit den späten 1980er Jahren rückte das philosophische Frühwerk Steiners, insbesondere seine "Ich-Philosophie", verstärkt in den Mittelpunkt der Rezeption. Diese Neudeutung, oft als Kontrapunkt zur späteren Kosmologie, betonte die individuelle Freiheit und die Selbsterschaffung des Menschen, was der Anthroposophie im 21. Jahrhundert neue Impulse verlieh und zur Abkehr von dogmatischeren Interpretationen führte. Der „philosophische“ Steiner mit seinen Verbindungen zum Anarchisten Mackay war nun etwas ganz anderes als der Apokalyptiker. Steiner konnte - so zeigte sich wieder einmal- auch ganz anders. Er konnte sogar beitragen zu einer Ich- Vorstellung, die nichts Deterministisches im Sinne von Karma und Moral auswies und somit hervorragend in die Selbstverwirklichung- Konzepte zur und nach der Jahrtausendwende passte. Steiner wurde jetzt wieder einmal modern interpretiert und umgedeutet.
Apropos Deutungshoheit und politische Ambivalenzen, ja sogar ideologische Verstrickungen: Martins beleuchtet in seinem Artikel auch die komplexen und oft widersprüchlichen politischen Affiliationen der Anthroposophie, die von einer anfänglichen Nähe zum Nationalsozialismus (trotz des Verbots der Gesellschaft 1935) bis hin zu späteren Verbindungen mit der Friedens- und Umweltbewegung reichten. Diese Ambivalenzen zeigen die Anfälligkeit der Bewegung für ideologische Instrumentalisierung und ihre Schwierigkeiten, sich von problematischen Elementen konsequent zu distanzieren. Die jeweiligen Protagonisten in den Führungsebenen sind meist gar nicht die treibenden Kräfte, gerade wenn es um ideologisch fragwürdige Positionierungen geht.
Der Mangel an Stil, Feingefühl und einer gewissen Reife des Urteils ist immer wieder eklatant. Das wurde gerade in der Corona- Zeit überdeutlich. Ein Hetzer, Antisemit und Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann war zu der Zeit Posterboy und Haus- Ideologe eines anthroposophischen Babybrei- Herstellers. Die Distanzierung erfolgte auch in diesem Fall erst, als die Umsätze einbrachen, keinesfalls aus Einsicht.
Natürlich ist die Kommerzialisierung der anthroposophischen Bewegung längst vollzogen und bestimmt maßgeblich die öffentliche Wahrnehmung: Die heutige Rezeption der Anthroposophie wird maßgeblich durch den Erfolg ihrer Praxisfelder (z.B. Waldorfschulen, Weleda, Demeter) geprägt. Diese haben sich zu etablierten Marken entwickelt, die der breiten Öffentlichkeit eine "sanftere", weniger esoterische Zugangsweise zur Anthroposophie bieten. Ganz offensichtlich stehen die dauerhaften Kontroversen der leicht in die Nabelschau verfallenden Anthroposophie ganz gut. Trotz der - manchmal nicht ganz freiwilligen- Anpassungen an den Zeitgeist bleibt die Anthroposophie Gegenstand anhaltender interner und externer Debatten, insbesondere hinsichtlich Steiners Rassentheorien. Ansgar Martins betont die Notwendigkeit einer konsequenten Historisierung von Steiners Ideen und einer kritischen Distanzierung von problematischen Inhalten, um die Glaubwürdigkeit der Bewegung zu wahren oder - je nach Standpunkt des Betrachters- auszubauen.
Hilfreich dabei ist die digitale Revolution, die als Katalysator neuer Diskurse dient. Die weitreichende Verfügbarkeit von Steiners Werken in digitaler Form hat zusätzlich zu einer Demokratisierung der Rezeption geführt. Dies ermöglicht nicht nur eine tiefere und breitere Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk, sondern fördert auch die Entstehung neuer, oft häretischer und kritischer Auslegungen, die das traditionelle Steiner-Bild herausfordern.
Disclaimer: Diese Betrachtung ist keine exakte Wiedergabe des Aufsatzes Ansgar Martins, sondern eine freie Interpretation der von mir so gesehenen Grundthesen.
_____________________
1 Viktoria Vitanova-Kerber, Helmut Zander (Hrsg.) A N T H R O P O S O P H I E -
F O R S C H U N G. F O R S C H U N G S S TA N D - P E R S P E K T I V E N - L E E R S T E L L E N. Beiträge zur Nichthegemonialen Innovation Herausgegeben von Christian Kassung, Sylvia Paletschek, Erhard Schüttpelz und
Helmut Zander. Band 7, Ansgar Martins
Apokalyptik, Sozialreform und Ich-Philosophie. Über einige
Entwicklungen und Neuansätze in der deutschsprachigen
Anthroposophie nach dem Tod Rudolf Steiners 1925 Seite 43f