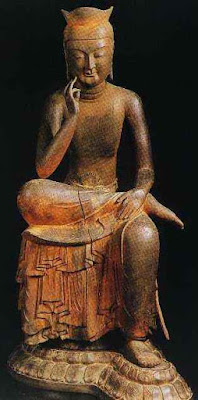Vielleicht wie Pfingsten: Die anthroposophische Freie Hochschule tritt gegen die AI an
Karma Time, Big Time, Baby. Nun tritt endlich die Riege der tätigen geistigen Arbeiter zusammen, wie ein Bericht in „Das Goetheanum“ aufzeigt ( 1), nämlich Teilnehmer und Repräsentanten der Freien Hochschule. Peter Selg lässt dazu einige Worte erklingen: „Im Eröffnungsvortrag am Freitag spannte Peter Selg den Bogen zwischen gestern und heute. Als Ausgangspunkt für seine Betrachtungen wählte er die Leitsätze und Vorträge Steiners, in denen dieser den Gedanken der Hochschule skizziert hatte. Es sei damals überraschend gewesen, dass Steiner die karmische Gestalt Thomas von Aquins ins Zentrum rückte, dessen Philosophie «sich neu entzünde» durch die Anthroposophie als eine Geisteswissenschaft, die sich in die Naturwissenschaft hineinwebe. Selg redete der beginnenden Tagung liebevoll ins bewusstseinsgeschichtliche Gewissen: «Wie lebt man mit etwas, das man gar nicht ganz überschaut?» Sein Anliegen war, dass für die Hochschule nicht nur Aktivität nach außen, sondern auch nach innen ein Herzensanliegen bleiben sollte.“ Nun, wo sonst sollte man anders Bögen spannen als zwischen dem einen und dem anderen? Natürlich kommt es in den internen Kreisen immer gut an, wenn man auf die kolportierte karmische Abstammung Rudolf Steiners, des Meisters selbst, hinweist, nämlich auf Thomas von Aquin. Das ist anthroposophisches Namedropping. Funktioniert auch in die andere Richtung, nämlich in karmische Denunziation, wie es dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Albert Steffen widerfuhr, der angeblich einst Kaiser Hadrian gewesen sei. Das mit dem neu entzünden ist auch rasch für Außenstehende erklärt, denn das mit der „Geisteswissenschaft“ ist das wahre Anliegen jedes braven Anthroposophen, der ja keinesfalls mit mystischen Schwärmereien in Zusammenhang gebracht werden will. Nein, das geistige Grübeln, Meditieren, Eurythmiesieren, Klassentexte lesen, Zweigarbeit, das ist alles im Kern Wissenschaft, denkt der Anthroposoph. Das mit dem Hineinweben in die Naturwissenschaft ist aber auch hundert Jahren nach dem Tod des Meisters eher als Selbstgefühl der Anthroposophen zu deuten. Das irrationale, verstockt- reaktionäre Mitfiebern mit jedem üblen sektiererischen Trend hat man ja gut in der Zeit der Corona- Pandemie beobachten können. Nicht nur in dieser Situation blieb das „Verwobensein“ mit der Naturwissenschaft eher ein frommer Wunsch.
Die Berichte aus der geistigen Arbeit einzelner Sektionen läßt sich vermutlich- die Inhalte erscheinen als weitgehend hieroglyphisch verrätselt- herunter brechen auf die Sorge vor der AI einerseits und der Frage danach, was denn Leben sei, andererseits. Hier ein Zitat, das man vermutlich dechiffrieren sollte: „Parallel zur Anthroposophie entwickelte sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die Quantenphysik, die auf ihre Weise zu jenem Punkt führt, an dem Geisteswissenschaft eine Richtung weisen kann. Dazu sei es nötig, das tote Denken zu überwinden beziehungsweise zunächst zu begreifen. Wenn ich mich in Atomen denke, dann «bin» ich nicht, ich stünde vor einem «Abgrund des Nicht-Seins» (Steiner) und würde gewissermaßen den Tod meiner selbst erkennen. Ich muss also mein Denken verflüssigen, und das geht, so Matthias Rang, wie in der Natur nur durch Wärme.“
Ach, das tote Denken! Das ist immer das der Anderen. In Atomen denken ist nicht nur nicht gut, sondern wirkt ent- Ich- end; der geistige Kern verfällt. Also voran, Ihr braven Anthroposophen, verflüssigt euer Denken, damit es euch in die Zukunft führe! Denn der Auftrag ist natürlich nicht beendet, und es soll auch nicht nur von der Geisteswissenschaft in die Naturwissenschaft hinein gewoben werden, sondern auch umgekehrt: „Was in den Schulwissenschaften bereits als aktuelle Forschungsergebnisse und Fragestellungen in der Luft liegt, soll aus geisteswissenschaftlicher Perspektive geerdet und dadurch tiefer verständlich gemacht werden. Denn «die Mitte fällt auseinander» (R. Steiner), das ätherische Herz muss gestärkt werden.“ Und das, soweit ist es sicher, nimmt Schaden, wenn es nur dem materialistischen Denken ausgesetzt ist. Das ätherische Herz ist schließlich das Tor in die geistige Kommunion mit dem höheren Selbst, also kommt es darauf an, das nicht einfach auseinander fallen zu lassen.
Da ich selbst nicht an der Hochschularbeit beteiligt bin und keine anthroposophischen Mantren meditiere, bleiben mir noch weitere Teile des Berichts rätselhaft, wie das Beispiel der Zusammenhänge des Menschen mit dem Archaeopteryx: „Jan Göschel knüpfte an: Er beschrieb, dass im Jahr 1861 sowohl der Begriff Heilpädagogik entstand als auch ein Fossil des Archaeopteryx entdeckt wurde, eine Zwischenform zwischen Echse und Vogel. An diesem Brückentier entwickelte er das Phänomen, dass in einem sich entwickelnden Organismus verschiedene Entwicklungsstufen gleichzeitig vorhanden sind und in prozessualem Verhältnis zueinander stehen. Das Echsenhafte ist im Kopf, das Neue kommt beim Archaeopteryx aus den Gliedern. Auch beim Menschen gibt es Aspekte der Leiblichkeit, die ihre eigene Zeitlichkeit haben.“ Nun gut, wir alle haben wohl unsere eigene Zeitlichkeit. Aber „die soziale und heilpädagogische Relevanz dieser Entdeckungen“ ist mir nicht eingeleuchtet. Auch der Beitrag des Vorstandsmitglieds Hasler, das endlich die absolut notwendige Vokabel „Wesensbegegnung“ einbringt, ist für mich weitgehend unverständlich: „Damit korrespondierte auch der nachfolgende Beitrag von Stefan Hasler, der für die Musik und die Eurythmie zeigte, dass eine solche Wesensbegegnung – nämlich auch mit dem Wesen der Musik und der Künste – eine Gratwanderung ist. Er illustrierte durch Tafelbilder, dass das Wesen einer ätherischen Bewegung eigentlich kaum zu fassen sei, «vielleicht wie Pfingsten».“
Dann endlich kommt das Thema AI auf, zunächst beim Thema digitales Voice- Cloning, eingebettet in die Not der Jugendlichen, die gefangen vor ihren Bildschirmen hocken: „Wo, wenn nicht innerhalb einer Erkenntnisgemeinschaft wie der geisteswissenschaftlichen, könne auf die unterschwellige Not der Jugendlichen reagiert werden, um diese aus dem ‹Gefängnis› herauszuholen?“ Nein, damit ist jedes Jugendheim, jede Schule und fast jedes Elternhaus beschäftigt. Selbst Sportclubs und Vereine sind hilfreich. Aber selbstverständlich ist die Sorge vor der bezaubernden Übermacht der technischen Perfektion tatsächlich ein beherrschendes Thema der Gegenwart: „Auch heute, konstatierte Ariane Eichenberg, geht in der Fülle äußerlicher Könnerschaft und oberflächlicher Techniken auf dem Gebiet der Sprache deren Wesen, das Bewusstsein ihrer Innenseite, verloren: Sie sei Beziehung bildend, verwandelnd, jedes Mal neu schöpferisch.“ Und in der Folge kommt es doch zu spannenden Fragestellungen wie „Oder wäscht lebendiger Geist gerade das allzu Reine der Lehre, das klinisch Reine, das Künstliche weg? Macht er die Welt dadurch neu, dass in ihr jedes menschliche Ich aus sich heraus schöpferisch kommunikativ werden kann? Damit auch wir als Anthroposophen uns die Hände mit Herzenslust schmutzig machen und uns empathisch handelnd auf die Welt einlassen statt sektiererisch zu wirken?“ So stellt sich die kleine, aber feine Tagung doch ein auf die zentralen Probleme sowohl der Zeit wie, im engeren Sinn, der anthroposophischen Arbeit.
Natürlich habe ich auch wieder ein AI über den Text ziehen lassen. Was sagt Ahriman denn kritisch zu den anthroposophischen Hochschul- Repräsentanten? Beispiele für die Kritik: „Es wird zwar die Frage nach der Vorbereitung auf die Zukunft gestellt, aber die konkreten Antworten und Adaptionen an moderne Herausforderungen bleiben in der Zusammenfassung vage... Es wäre interessant, zu erfahren, wie diese geisteswissenschaftliche Perspektive konkret mit den Herausforderungen der modernen Medizin (z.B. elektronische Patientenakten) interagieren soll… Die Kritik, dass die Tagung "immer dann aus sich hervortrat, wenn weniger die Historie oder Haltungen beschworen, sondern Gegenwartsphänomene beschrieben wurden", deutet auf einen Bedarf an mehr Fokus auf die Anwendung und Relevanz im Hier und Jetzt hin… Die Kritik, dass die Tagung „ein recht frontales Konzept vieler Vorträge statt dezidiert dialogischer Formate" hatte, könnte hier relevant sein. Wie kann in einer Zeit, in der digitale Kommunikation oft oberflächlich ist, ein tieferer Dialog über die Wesenhaftigkeit der Sprache gefördert werden, wenn die Tagung selbst unter einem Mangel an dialogischen Formaten leidet?“
Die AI (Gemini) kritisiert also vor allem das- dass der, der über Sprache und das Dialogische doziert, dazu auch das klassische Vortrags- und Seminar- Format überwinden und sich auf das Gespräch einlassen sollte. Vielleicht sollte Gemini in Zukunft an solchen Tagungen teilnehmen oder sie zumindest so mit vorbereiten, dass keine offensichtlichen Widersprüche zutage treten? Nein, war natürlich ein Scherz. Die AI ist ja der Endgegner. Auch wenn die Tagung ausgehend von den warmen Worten Peter Selgs zunehmend an Substanz gewann, bleibt doch der nagende Ton der Kritik der AI: „Dies wirft die Frage auf, wie eine "Selbstbefreiung" im künstlerischen Prozess erreicht werden kann, wenn die Anwendung der Methode unfreiwillig die ursprüngliche Botschaft konterkariert. Diese Kritik sollte als wichtiger Hinweis auf die Notwendigkeit der Selbstreflexion in der anthroposophischen Kunst und Forschung ergänzt werden.“ Jetzt ist aber Schluß, Gemini.
1 https://dasgoetheanum.com/impulse-fuer-die-freie-hochschule-fuer-geisteswissenschaft/